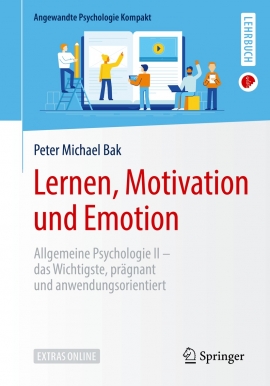Inhaltsübersicht
Kapitel 1: Lernen und Performanz
Kapitel 2: Assoziatives Lernen
Kapitel 5: Determinanten des Verhaltens
Kapitel 6:Triebtheorien der Motivation
Kapitel 8: Erwartungswerttheorien
Kapitel 9: Handlungstheoretische Ansätze
Kapitel 11: Was sind Emotionen?
Kapitel 12: Wie entstehen Emotionen?
Kapitel 13: Wozu haben wir Emotionen?
I Lernen
Kapitel 1: Lernen und Performanz
Es ist schon erstaunlich, was wir so alles im Laufe der Zeit gelernt haben, Fahrradfahren zum Beispiel. Was uns vielleicht heute ganz selbstverständlich erscheint, war irgendwann einmal eine kaum lösbare Aufgabe. Wir mussten Schritt für Schritt lernen, das Gleichgewicht zu halten, gleichzeitig in die Pedale zu treten und dann auch noch den Lenker so zu halten, dass wir in die gewünschte Richtung fahren. Wie heißt es so schön: Übung macht den Meister! Wir haben aber nicht nur durch Übung gelernt, sondern manches einfach dadurch, dass wir bestimmte, womöglich nur einmalige Erfahrungen gemacht haben. So mag es ausreichen, ein einziges Mal mit der Hand eine heiße Herdplatte berührt zu haben, um das in Zukunft ein für alle Mal zu vermeiden. Viele Verhaltensweisen sind, wie wir noch sehen werden, ein Ergebnis von Lernprozessen.
Kapitel 2: Assoziatives Lernen
Es sind vor allem zwei theoretische Konzeptionen und dazugehörige Studien, die unser Verständnis vom assoziativen Lernen geprägt haben. Zum einen kennen wir das klassische Konditionierungslernen, das durch das „Experiment mit dem Hund und der Glocke“ des russischen Mediziners und Physiologen Ivan Petrovič Pavlov (1849–1936) weltbekannt wurde. Anhand dieses Experiments kann man aufzeigen, wie die Bedeutung von Reizen gelernt wird. Zum anderen ist die operante Konditionierung zu nennen, die die Grundlage der behavioristischen Lerntheorie bildet und von Forschern wie Clark Hull oder Burrhus Skinner weiterentwickelt wurde. Sie erklärt, wie wir durch die Konsequenzen unseres Verhaltens lernen.
Kapitel 3: Modelllernen
Bisher haben wir Lernen stets unter der Perspektive betrachtet, dass ein Organismus in einer Lernphase etwas erfährt und dann in einer Abrufphase geprüft wird, ob die Erfahrungen aus der ersten Phase das Verhalten verändern. Vieles was wir im Leben lernen, lernen wir aber gar nicht, weil wir selbst die Erfahrungen machen, sondern weil wir beobachten, was anderen geschieht. Der jüngere Bruder lernt beispielsweise, den Vater lieber nicht beim Mittagsschlaf zu stören, weil er erlebt hat, was seiner älteren Schwester passierte, als sie dies tat. Ganz im Sinne des Vermeidungslernens lässt er seinen Vater lieber in Ruhe. Vieles, was wir lernen, lernen wir in einem sozialen Kontext, in der Interaktion mit anderen Menschen. Sie stehen uns quasi als Modelle zur Verfügung, wir ahmen sie nach oder imitieren sie, häufig ganz automatisch.
Kapitel 4: Implizites Lernen
Explizites Lernen kennzeichnet absichtsvolles, bewusstes Lernen, wie es etwa bei der mathematischen Beweisführung oder weitgehend beim Erlernen einer Fremdsprache im Sprachunterricht stattfindet. Unter implizitem Lernen versteht man dagegen Lernen, das unbewusst geschieht.
II Motivation
Kapitel 5: Determinanten des Verhaltens
Warum lesen Sie eigentlich gerade diese Zeilen? Vielleicht, weil Sie den Stoff für die nächste Prüfung lernen müssen? Oder weil Sie das Thema spannend finden? Und warum machen Sie die Prüfung? Und warum finden Sie das Thema spannend? Was also motiviert Sie eigentlich gerade dazu, die Zeit mit diesem Buch zu verbringen?
Kapitel 6:Triebtheorien der Motivation
Triebtheorien haben generell ein mechanistisches Bild motivierten Verhaltens. Die Grundidee ist, dass es biologische Grundbedürfnisse gibt, die befriedigt sein wollen. Sind sie das nicht, entsteht eine Spannung, die irgendwann so groß geworden ist, dass sie entsprechend triebreduzierendes Verhalten in Gang setzt. Ganz ähnlich wie der Dampfkessel einer Lokomotive einen bestimmten Druck benötigt, um die Maschinen in Gang zu setzen, bedarf es auch beim Menschen eines Mindestmaßes an Spannung.
Kapitel 7: Feldtheorie
Eine im Vergleich zu den Triebtheorien völlig andere Beschreibung und Erklärung für menschliches Verhalten liefert die Feldtheorie von Kurt Lewin (1890–1947). Menschliches Verhalten wird nicht mehr durch biologisch bedingte Triebe erklärt, sondern im jeweiligen Kontext betrachtet und analysiert. Damit bietet uns die Feldtheorie eine nach wie vor sehr moderne Konzeption zur ganzheitlichen Betrachtung unseres Verhaltens.
Kapitel 8: Erwartungswerttheorien
In den bisherigen Betrachtungen ist die Person selbst als Protagonist und Entscheider über ihr Handeln kaum in Erscheinung getreten. Innerhalb der Triebtheorien war Motivation eine Kraft, die aus ungestillten (biologischen) Bedürfnissen resultierte. Die Feldtheorie berücksichtigt dagegen schon personale Faktoren, doch die Person als reflektierender Agent, der vor der Wahl verschiedener Handlungsoptionen steht, bleibt auch hier höchstens am Rande sichtbar. Erwartungswerttheorien der Motivation rücken nun die Überlegungen in den Mittelpunkt, die vor einem möglichen Handeln stehen und uns erst zu diesem führen. Motiviertes Verhalten wird hier als Ergebnis einer rationalen Alternativenabwägung bzw. Nutzenmaximierung angesehen, ist also das Ergebnis einer Entscheidung.
Kapitel 9: Handlungstheoretische Ansätze
Handlungstheoretische Ansätze rücken die Person mit ihren Zielen und Bedürfnissen als intentional handelndes Wesen in den Mittelpunkt. Wir verfolgen Absichten, stoßen dabei auf Hürden, Barrieren oder Chancen und Möglichkeiten und passen uns fortwährend an die Gegebenheiten an. Man kann handlungstheoretische Ansätze durchaus als Versuch ansehen, menschliches Verhalten ganzheitlich zu betrachten. Während beispielsweise in behavioristischen Theorien kognitive Aspekte unberücksichtigt bleiben, spielen freie Entscheidungen der Person in triebtheoretischen Ansätzen keine Rolle. Handlungstheoretische Konzeptionen versuchen dagegen menschliches Handeln im Kontext emotionaler, kognitiver, motivationaler und umweltbezogener Faktoren sowie von deren Wechselwirkungen zu betrachten.
Kapitel 10: Motive
Unsere bisherigen Betrachtungen bezogen sich in erster Linie auf die Frage, wie es überhaupt zu motiviertem Verhalten kommt, was ein solches Verhalten auslöst oder antreibt. Menschen unterscheiden sich jedoch darin, wie sie die Welt um sich herum wahrnehmen, was sie als besonders motivierend empfinden oder welche Reize bei ihnen zu welchem Verhalten führen. Es gibt Menschen, die dazu neigen, sich permanent mit anderen messen zu wollen. Für andere wiederum ist die soziale Gemeinschaft besonders wichtig, um sich sicher und sozial eingebunden zu fühlen. Je nachdem, welche dispositionalen Präferenzen wir besitzen, welche Motive bei uns dominieren, Situationen wahrzunehmen und zu bewerten, resultieren daraus ganz unterschiedliche Verhaltensweisen.
III Emotionen
Kapitel 11: Was sind Emotionen?
Haben Sie sich heute schon geärgert? Oder vielleicht schon über etwas gefreut? Waren Sie stolz auf etwas oder haben Sie sich geekelt? Dann haben Sie offensichtlich eine Emotion erlebt! Ärger, Ekel, Freude, Stolz, Wut, Überraschung, Enttäuschung, unser emotionales Repertoire ist vielfältig. Emotionen können unangenehm sein, manchmal erleben wir sie sogar als störend. In anderen Situationen können wir nicht genug davon bekommen. Mehr noch, wir versuchen alles, um bestimmte Emotionen noch einmal zu erleben. Emotionen sind, so könnte man etwas flapsig sagen, tatsächlich „das Salz in der Suppe“ unseres Erlebens.
Kapitel 12: Wie entstehen Emotionen?
Emotionen umfassen ein sehr komplexes subjektives Geschehen, das in jedem Fall mit einem (körperlichen) Gefühl assoziiert ist. Auf die Frage, wie wir uns überhaupt die Entstehung von Emotionen vorstellen können, gibt es nach wie vor viele unterschiedliche Antworten. Das Gleiche gilt für den genauen Zusammenhang zwischen körperlichen Empfindungen und psychischem Erleben. Auch hier gibt es verschiedene, empirisch mehr oder weniger gestützte Annahmen. Betrachten wir im folgenden Kapitel verschiedene Theorien der Emotionsgenese etwas genauer.
Kapitel 13: Wozu haben wir Emotionen?
Wie öde wäre ein Leben ohne Emotionen, ohne das überwältigende Gefühl der Freude bei der Geburt des eigenen Kindes oder den Schmerz beim Verlust einer geliebten Person. Andere Ereignisse lassen uns dagegen kalt, wir empfinden keine Regung. Offensichtlich sagen uns Emotionen etwas über die Bedeutsamkeit von Ereignissen. Sie verändern dabei gleichzeitig die Art und Weise, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Wir kennen das alle: Sind wir traurig, erscheint uns die Welt grau und wir kommen nur schlecht auf positive Gedanken. Sind wir dagegen glücklich, dann sieht die Welt ganz anders aus, unsere Gedanken und Gefühle sprudeln nur so aus uns heraus. Irgendwie begleiten uns Emotionen permanent, in dem was wir tun und erleben. Welche Funktion haben sie?